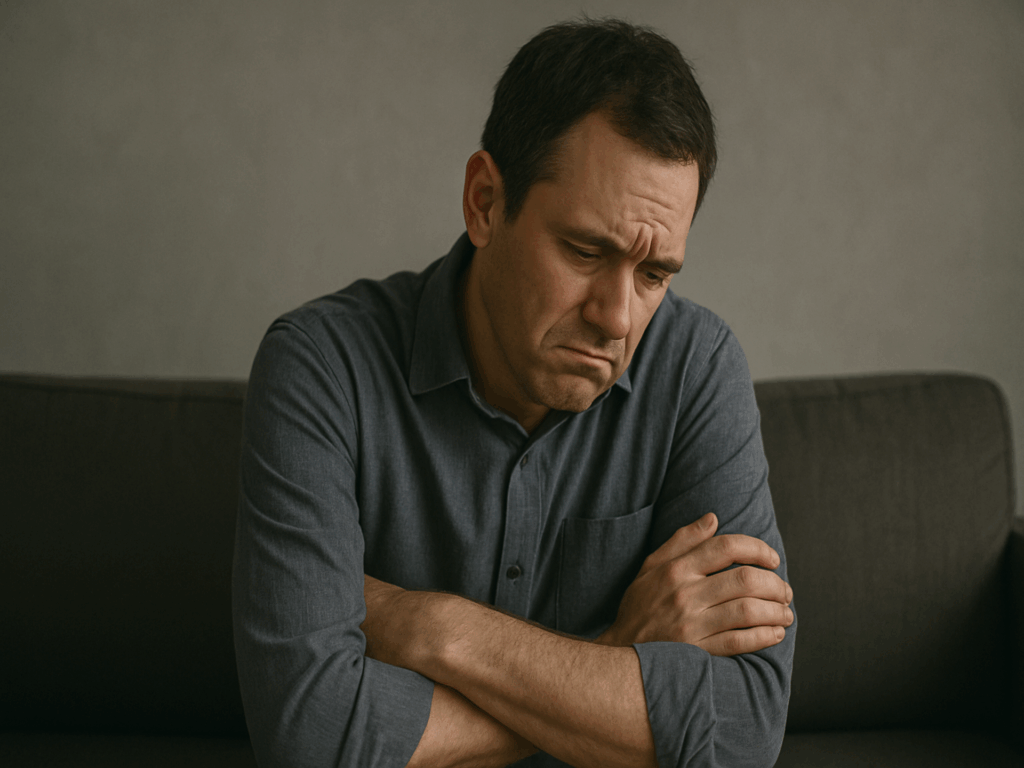Innere Unzulänglichkeit bei Autismus und ADHS
Es gibt Themen, über die spricht man nicht. Nicht in der Therapie, nicht mit Freundinnen, nicht mal mit sich selbst. Zum Beispiel darüber, dass man morgens schon mit dem Gefühl aufwacht, versagt zu haben. Obwohl man gestern alles gegeben hat. Dass man mitten im beruflichen Erfolg das dringende Bedürfnis verspürt, zu verschwinden. Dass man Komplimente nicht annehmen kann, weil man sicher ist, jemandem nur etwas vorgemacht zu haben. Und dass man sich innerlich für jeden Moment von Erschöpfung, Chaos oder Bedürftigkeit schämt. Was das mit Autismus und ADHS zu tun hat? Leider eine ganze Menge.
Wenn Leistung zur Pflicht wird
Viele neurodivergente Menschen entwickeln früh eine Art inneres Betriebssystem, das auf einem einfachen Prinzip basiert: Tu mehr, sei perfekter, mach’s wett. Und zwar alles. Die Reizoffenheit, die soziale Unsicherheit, die Impulsivität, die Erschöpfung, die langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit, das Nicht-mithalten-Können. Was daraus entsteht, ist oft ein Leben in ständiger Hochleistung hinter den Kulissen. Und gleichzeitig ein chronisches Gefühl von „Ich genüge nicht.“ Nicht im Job, nicht im Studium, nicht als Elternteil, nicht in Freundschaften. Und vor allem nicht im Vergleich zu den unsichtbaren Maßstäben, die man selbst mit sich herumträgt. Dabei liegt das Problem nicht im Können, sondern im inneren Druck, sich ständig beweisen zu müssen, obwohl man längst bewiesen hat, dass man es kann.
Viele Betroffene sagen Dinge wie: „Ich weiß, dass ich eigentlich ganz schön viel schaffe. Aber ich habe ständig Angst, dass jemand merkt, dass ich in Wahrheit überfordert bin.“ Oder: „Wenn ich mal eine Pause brauche, fühle ich mich sofort faul und wertlos.“ Oder: „Ich trau mich oft nicht, nach Hilfe zu fragen, weil ich denke, ich müsste das doch allein können.“ Und manchmal reicht schon ein einziges Meeting, eine spontane Frage oder ein ungeplanter Anruf und schon macht sich das Gefühl wieder breit: Ich bin zu langsam. Ich bin zu empfindlich. Ich krieg das alles nicht hin. Obwohl man rein objektiv hochqualifiziert ist, funktional im Alltag und vielleicht sogar für andere eine Art Vorbild.
Diese innere Unversöhntheit mit der eigenen Leistungsfähigkeit ist kein Persönlichkeitsproblem. Sie ist eine Folge jahrelanger Erfahrung, immer irgendwie aus dem Raster zu fallen. Ein besonders irritierender Aspekt ist, dass Lob alles oft noch schlimmer. macht. Denn es verstärkt das Gefühl, etwas vorgespielt zu haben. Es entstehen Gedanken wie: „Wenn du wüsstest, wie schwer mir das gefallen ist“, oder: „Warte ab, bis du den Moment erlebst, in dem ich versage.“ Man strengt sich so sehr an, alles richtig zu machen, dass man irgendwann den eigenen Maßstab aus den Augen verliert. Statt zu merken, wie viel man leistet, vergleicht man sich mit einer hypothetischen neurotypischen Version seiner selbst – und verliert jedes Mal.
Zwischen Außenwirkung und innerem Druck
Nach außen sieht man ja funktional aus. Angepasst und organisiert. Witzig vielleicht, kompetent sowieso. Aber was es kostet, merkt niemand. Dass hinter jeder E-Mail stundenlanges Zerdenken steckt. Dass der spontane Anruf erst nach zwei Tagen beantwortet wird, weil man dreimal ansetzen musste. Dass man in Gruppen lieber schweigt, weil man nicht weiß, wann man überhaupt etwas sagen darf, und sich später stundenlang dafür schämt, dass man wieder nichts beigetragen hat. Diese Diskrepanz zwischen Außenbild und Innenleben kann auf Dauer zermürbend sein. Man funktioniert, aber man fühlt sich nicht echt. Und mit jeder weiteren gut gemeinten Rückmeldung wie „Du wirkst doch total souverän“ wird das Gefühl stärker, irgendwie in einer Rolle festzustecken, die nicht die eigene ist.
Neurodivergente Menschen berichten oft von einem inneren Scanner, der ständig in Betrieb ist. Wie wirke ich gerade? War das jetzt zu viel? Bin ich wieder ins Wort gefallen? Hätte ich die E-Mail anders formulieren sollen? War das Lachen an der richtigen Stelle? Diese Dauerüberwachung kostet Kraft. Und sie verhindert, dass man sich in Beziehungen wirklich sicher fühlt. Denn sobald etwas gut läuft, kommt der Gedanke: „Das wird nicht halten. Bald merkt jemand, wie anstrengend ich eigentlich bin.“
Versagensängste klingen nach Schwäche. Und viele neurodivergente Menschen haben gelernt, dass Schwäche nicht gut ankommt. Dass man nicht mit Überforderung, Unsicherheit oder Selbstzweifeln auffallen darf, gerade weil man schon anders ist. Viele wollen nicht jammern. Sie wollen einfach nur dazugehören. Oder zumindest nicht noch mehr auffallen, als sie es ohnehin schon tun. Also wird geschwiegen. Über das Gefühl, nie wirklich zu genügen. Über die Angst, eine Enttäuschung zu sein. Über den ständigen Druck, alles kontrollieren zu müssen, damit niemand merkt, wie schwer manches eigentlich fällt.
Es kann entlastend sein, Worte für das eigene Erleben zu finden. Zu spüren, dass dieses Gefühl nicht komisch ist, sondern verständlich, wenn man sich anschaut, was dahinterliegt. Viele haben sich über Jahre an Abläufe und Erwartungen angepasst, die nie wirklich für sie gemacht waren. Was sich dann wie ein ständiges Nicht-genügen anfühlt, sagt oft nichts über den eigenen Wert. Es erzählt vielmehr davon, wie viel Kraft es kostet, in einem Umfeld zurechtzukommen, das nicht wirklich passt.